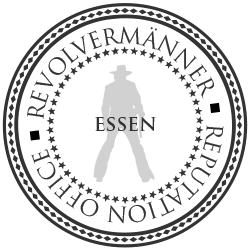Recht auf Vergessenwerden
“Der Mensch vergisst – Google nie”, lautet ein bekannter Ausspruch zur Halbwertszeit von im Internet gespeicherten Informationen. Dabei geht es allerdings nicht nur um die Suchmaschine und die damit verbundenen Google-Dienste. Sämtliche Kommentare und Bewertungen, die jemals irgendwo gepostet wurden, bleiben auf den Plattformen und in den Netzwerken bestehen, so lange sie bestehen – und das kann in der Regel lange dauern.
“Selbst, wenn eine Plattform ihre Pforten schließt, bedeutet das nicht, dass eine negative Bewertung aus der Welt ist”, sagt Kommmunikationsexperte und Reputationsmanager Christian Scherg gegenüber dem Online-Magazin ingenieur.de. “Da gibt es immer noch die Suchmaschinen, in denen der längst gelöschte Eintrag immer noch als Suchergebnis auftauchen kann.”
Die Rechtslage dazu ist klar. Laut Paragraph 17 der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) hat jeder Bürger in Europa ein Anrecht darauf, dass Kommentare, Suchergebnisse oder andere ursprünglich rechtmäßige Veröffentlichungen im Internet auf Antrag gelöscht werden müssen. Soweit jedenfalls die Theorie.
“Das Recht auf Vergessenwerden wäre im Grunde eine großartige Angelegenheit – wenn es nicht das öffentliche Informationsinteresse gäbe”, sagt Christian Scherg. “Es kommt also auf den Vorgang an sich an, aber auch auf den Zeitpunkt, wie lange der Eintrag zurückliegt.”
Das Recht auf Vergessenwerden ist also kein Grundrecht, das automatisch gilt. Es muss in jedem Fall explizit eingefordert werden. “Ob ein Löschantrag Erfolg hat, hängt von der Kombination aus öffentlicher Relevanz und Zeitpunkt des Eintrags ab. Wer Informationen über eine zehn Jahre zurückliegende Zwangsversteigerung entfernt haben möchte, weil sie seinen Ruf und sein berufliches Fortkommen schädigen, wird sich damit mit hoher Wahrscheinlichkeit durchsetzen können. Wer allerdings unter Zuhilfenahme einiger C4-Pakete ein Polizeirevier in die Luft gejagt hat, wird sich auch nach zehn Jahren nicht auf einen Anspruch auf Vergessen berufen können.”
Beim Recht auf Vergessenwerden findet eine Abwägung zwischen den Werten Persönlichkeitsrecht, Informationsfreiheit und dem Recht auf freie Meinungsäußerung statt. Erst, wenn das Persönlichkeitsrecht der oder des Betroffenen im konkreten Fall höher einzuschätzen ist als die beiden anderen Werte, besteht ein Rechtsanspruch auf Löschung.
“Der einzige Weg, sich bei Vorgängen mit hohem öffentlichen Interesse zu schützen, ist die Anonymisierung”, sagt Christian Scherg. “In solchen Fällen empfiehlt es sich, Kontakt mit dem Veröffentlicher aufzunehmen und um eine Namensänderung oder um Kürzung des Nachnamens auf einen Buchstaben zu bitten.”
Der gute Ruf im Internet – ständiger Beobachtung wert

Besonders problematisch für die eigene Reputation im Internet ist die schleichende Verbreitung. Negative Bewertungen oder Kommentare können sich rasch viral ausbreiten, wenn man sie nicht rechtzeitig bemerkt und Gegenmaßnahmen einleitet.
“Den eigenen Namen oder den des eigenen Unternehmens zu googlen, sollte zur regelmäßigen Routine werden”, rät Christian Scherg. “Dabei sollten man den Begriff googeln nicht zu wörtlich nehmen. Die Suche sollte sich über alle wichtigen Suchmaschinen sowie alle wesentlichen sozialen Netzwerke und Plattformen erstrecken.”
Pandemien können auch in digitaler Ausprägung auftreten. Verbleiben negative Bewertungen oder Kommentare zu lange unbeachtet, sind sie und ihre Auswirkungen meist nur noch sehr schwer wieder einzufangen, wenn überhaupt. “Sobald sich die ersten Kunden mit Fragen zu Negativkommentaren melden, ist es meist schon zu spät. Besser ist, es gar nicht erst so weit kommen zu lassen.”
Besonderes Augenmerk sollte dabei den großen Anbietern wie Google gelten, aber auch unternehmensrelevanten Diensten wie Arbeitgeber-Bewertungsplattformen. Hier ist sowohl der Aufmerksamkeitsgrad als auch die Verbreitungsgeschwindigkeit besonders hoch.
Cybermobbing – eine Frage der Voraussicht
In Fällen von Cybermobbing ist das Recht auf Vergessenwerden von besonderer Brisanz. Erschwerend ist in diesem Umfeld, dass die Urheber der negativen Lautäußerungen nicht dem gewerblichen Umfeld entstammen und aus meist niederen Motiven handeln. “Das ist das Problem beim Cybermobbing: Man hat meist keinen vernünftigen Gesprächspartner”, sagt der Reputationsexperte.
Aus diesem Grund lautet die Devise: Vorsicht beim Upload! Nicht alles aus dem privaten Umfeld ist im viralen Minenfeld der sozialen Netzwerke gut aufgehoben. Was niemals im Internet aufgetaucht ist, muss später auch nicht mit großer Mühe wieder daraus entfernt werden.
“Vor jedem Klick auf den Senden-Button sollte man sich diese Frage stellen: Würde ich das auch als Annonce in die Zeitung setzen?”, rät Christian Scherg. “Jede Information über sich selbst ist eine Pandorabüchse. Ist sie einmal geöffnet, ist das Schließen eine äußerst mühselige Angelegenheit – besonders, wenn der Inhalt inzwischen entwichen ist.”
Was viele Nutzer sozialer Netzwerke zunächst nicht richtig einschätzen, ist der Schutzkreis, der ihre Postings umgibt. Die scheinbare Vertrautheit des eigenen Freundeskreises, für den die Beiträge und Bilder gedacht sind, besteht nur theoretisch. “Ein Foto, dass jemanden dabei zeigt, wie er oder sie mit glasigen Augen kopfüber von der Couch hängt, mag im persönlichen Freundeskreis durchaus sehr lustig sein. Dummerweise ist es auch Menschen außerhalb des definierten Freundeskreises zugänglich – dem Chef beispielsweise.”
Ähnliches gilt für Beiträge oder Videos, die politische Ansichten darstellen. Wer sich so artikuliert, sollte zunächst einen Werteabgleich vornehmen, denn die politische Aktivität kann sich durchaus auf die Erfolgsaussichten bei Bewerbungen auswirken. Auch Personalchefs haben meist eine politische Einstellung.
Recht auf Vergessenwerden – Fotos – digitale Zeitbomben für die eigene Reputation
In früheren Zeiten galten Fotos als ultimative Belege für die unverfälschte Darstellung von Tatsachen. Seit Photoshop und anderen Bildbearbeitungsprogrammen ist das nicht mehr der Fall. “Jedes Foto, das man von sich ins Internet hochlädt, kann die eigene Reputation gefährden, und das auf zweifache Weise”, sagt Christian Scherg.
Zum einen räumen sich die sozialen Netzwerke in ihren AGB umfangreiche Verwertungsrechte für jedes hochgeladene Foto ein. “Es kann durchaus vorkommen, dass man das eigene Gesicht unversehens in einer Facebook-Werbeanzeige wiederfindet. Das ist nicht immer eine positive Erfahrung.”
Zum anderen lassen sich Fotos in der Regel problemlos herunterladen und auf dem eigenen Computer verändern. “Wer das eigene Gesicht unversehens auf einem viral verbreiteten Pornofoto wiederfindet, wird auf dramatische Weise mit der Tatsache konfrontiert, das Fotos im Internet Freiwild sind”, warnt Christian Scherg. “Ein wenig Vorsicht und Zurückhaltung sind hier dringend angesagt, um persönliche Katastrophen zu vermeiden, die das ganze Leben beeinflussen können.”
Per Simulator zu mehr Empathie
Die massive Verbreitung von Cybermobbing geht vor allem auf die Anonymität zurück, aus der heraus die Täter agieren können. Aus der Sicherheit der meist nicht rückverfolgbaren Datenspur schöpfen viele Nutzer*innen den Mut, Dinge zu äußern, die sie im direkten persönlichen Kontakt nicht von sich geben würden.
“Die digitale Distanz führt oft zu einem fast vollständigen Verlust von Empathie”, sagt Christian Scherg. “Die Täter*innen halten ihre Aktivitäten für eine Ausprägung von Humor und machen sich nicht bewusst, welche dramatischen Schäden sie bei ihren Opfern anrichten.”
Der Kommunikationsexperte hält aus diesem Grund häufig Seminare in Schulen ab, in denen er über die Auswirkungen von Cybermobbing aufklärt. Ein wirksames Instrument ist dabei die Cybermobbing-Simulation, über die Schüler*innen am eigenen Leib erfahren können, wie es ist, andere zu mobben oder ein Opfer von Cybermobbing zu werden.
“Wir halten dazu ein simuliertes soziales Netzwerk bereit, in das sich die Schüler*innen unter Aufsicht einloggen und wie gewohnt aktiv werden können”, erklärt Christian Scherg. “Die Simulation ist äußerst lebensecht. Die Schüler*innen vergessen schon nach kurzer Zeit, dass es sich um eine Simulation handelt.”
Dann beginnen die verbalen Attacken auf die Nutzer*innen, die von einem Teil der eingeloggten Teilnehmer auf den Weg gebracht werden. Anhand der eigenen emotionalen Reaktionen erkennen die Schüler*innen, welche massiven Auswirkungen derartige Attacken haben können, besonders, wenn sie zuvor selbst noch nicht Opfer von Cyberattacken geworden sind.
“Noch interessanter sind die Reaktionen der Angreifer*innen”, berichtet Christian Scherg. “Sie erleben aus nächster Nähe, wie schnell die Empathie mit den Angegriffenen verloren geht und die gegenseitigen Attacken und Beleidigungen eskalieren.”
Die Erkenntnis stellt sich am Ende der Simulation in der Nachbesprechung ein. Die meisten Angreifer*innen sind in der Rückschau schockiert über ihr eigenes Verhalten und werten die Erfahrung als wertvolle Erkenntnis. “Was wir nach der Simulation am häufigsten hören: Jetzt wissen wir, was Cybermobbing so gefährlich macht und wie es sich auf die Opfer auswirkt”, berichtet der Kommunikationsexperte.
Das Ziel von Christian Scherg ist die möglichst häufige Anwendung der Simulation, um die Auswirkungen von Cybermobbing einem möglichst großen Kreis von Jugendlichen vor Augen zu führen und sie für die besondere Problematik zu sensibilisieren.
“Es geht darum, eine grundsätzliche Botschaft zu verbreiten”, sagt Christian Scherg. “Cybermobbing ist kein Scherz oder Kavaliersdelikt. Es ist eine Straftat. So einfach ist das.”